Jüdischer Alltag ist das, was man daraus macht. Konkret bedeutet dieser Satz, dass es allen Jüdinnen und Juden letztendlich selbst überlassen bleibt, inwieweit man seine Religion im Alltag praktiziert – schließlich ist das immer auch eine ganz individuelle Entscheidung. Dennoch existiert seit vielen Jahrhunderten ein Regelwerk, das für jede oder jeden gleichermaßen Gültigkeit besitzt. Oder anders ausgedrückt: Es gibt viele Traditionen und Gebräuche, die sich vom Geburt bis hin zum Tod auf alle Abschnitte im Leben eines jüdischen Menschen beziehen. Das beginnt beispielsweise mit der Beschneidung eines neugeborenen Jungen am achten Tag nach seiner Geburt, der Brit Mila (hebr. Bund der Beschneidung), setzt sich mit der Bar oder Bat Mitzwa (hebr. Sohn/Tochter des Gebots) fort, wodurch die religiöse Mündigkeit eines Mädchen oder Jungen im Alter von zwölf beziehungsweise dreizehn Jahren markiert wird, und endet mit dem Gebot, dass ein Mensch innerhalb von 24 Stunden nach seinem Tod beerdigt werden sollte.
 Ebenso wie in allen anderen Religionen auch verleiht ein Kanon an Feiertagen dem Jahr eine ganz besondere Struktur, Gebete können den Tagesablauf bestimmen. Zudem kennt das Judentum eigene Symbole wie den Davidstern oder auch „Magen David“ (hebr. Schild Davids), die „Menora“ (hebr. Leuchter, Lampe), den siebenarmiger Leuchter, oder eine „Mesusa“ (hebr. Türpfosten), eine kleine Schriftkapsel, die am Türrahmen befestigt wird und so ein jüdisches Haus kennzeichnet. Last but not least sind da noch die jüdischen Speisevorschriften, die regeln, was gegessen werden darf, also was „koscher“ ist.
Ebenso wie in allen anderen Religionen auch verleiht ein Kanon an Feiertagen dem Jahr eine ganz besondere Struktur, Gebete können den Tagesablauf bestimmen. Zudem kennt das Judentum eigene Symbole wie den Davidstern oder auch „Magen David“ (hebr. Schild Davids), die „Menora“ (hebr. Leuchter, Lampe), den siebenarmiger Leuchter, oder eine „Mesusa“ (hebr. Türpfosten), eine kleine Schriftkapsel, die am Türrahmen befestigt wird und so ein jüdisches Haus kennzeichnet. Last but not least sind da noch die jüdischen Speisevorschriften, die regeln, was gegessen werden darf, also was „koscher“ ist.
Selbstverständlich gibt es ebenfalls eine Unterscheidung zwischen öffentlicher und privater Sphäre, also der Synagoge, womit genau die Räumlichkeiten bezeichnet werden, in denen sich Juden versammeln, um zu beten, Lesungen aus der Torah zu hören, zu lernen oder den Schabbat und die Feiertage einzuleiten. Doch auch die eigenen vier Wände sind ein wichtiger Ort, an dem Traditionen gepflegt werden und die Familie oftmals mit Gästen zusammenkommt, um dort gemeinsam anlässlich des Schabbats, des jüdischen Neujahrsfestes „Rosch Haschana“ (hebr. Kopf des Jahres) oder dem „Seder“(hebr. Ordnung) zu Beginn von Pessach nicht nur wichtige religiöse Texte zu lesen, sondern auch ausgiebig zu essen und ordentlich zu feiern.
 Gebete
Gebete
Religiöse Jüdinnen und Juden beten drei Mal am Tag, und zwar das Morgen- (Schacharit), das Nachmittags- (Mincha) sowie das Abendgebet (Ma’ariv). Am Schabbat oder den Feiertagen kommt mit dem Mussaf (hebr. Zusatz) noch ein weiteres hinzu. Sie alle sollen – so jedenfalls schreibt es die Torah vor – ein Herzensdienst sein, der für Frauen und Männer gleichermaßen verbindlich ist, auch wenn in manchen Gemeinden das dabei mitgebetete „Schmone Essre“ (hebr. Achtzehn) für Männer dreimal, für Frauen aber nur einmal verpflichtend sein kann. Vor dem Morgen- und Abendgebet wird noch das „Schma Israel“ (hebr. Höre Israel) gesprochen, das wohl bekannteste jüdische Gebet, das sich zudem wie ein Glaubensbekenntnis liest. Und wer eines der drei täglichen Gebete – vorausgesetzt es geschah unabsichtlich – verpasst hat, kann dieses durch eine Wiederholung beim nächsten Gebet quasi nachholen.
Die Gebetszeiten markieren nicht nur wichtige Stationen des Tagesablaufs. Vielmehr sollen sie von ihrer Chronologie her auch an die Reihenfolge der Opfer erinnern, wie sie einst im Tempel in Jerusalem dargeboten wurden. Dieser wurde im Jahr Jahr n.d.Z. von den Römern zerstört, weshalb den Gebeten selbst eine Art Ersatzfunktion zukommt, die für die in alle Welt verstreuten Juden somit identitätsstiftend werden sollte. Neben der für Männer verpflichtenden „Kippa“ (hebr. Kappe), der kleinen kreisförmigen Mütze aus Stoff oder Leder, die den Hinterkopf bedeckt, werden zum Gebet ebenfalls ein Gebetsschal, der Tallit, und die Tefillin, schwarze Lederriemen, die man sich um Arm und Finger wickelt, sowie einer Gebetskapsel mit einem Text aus der Torah, welche wiederum an der Stirn appliziert wird, benötigt. Während Kippa, Tallit und Tefillin in der Orthodoxie und dem konservativen Judentum ausschließlich Männern vorbehalten bleiben, sind sie in der reformorientierten Strömung gleichfalls bei Frauen üblich geworden.
Synagoge
Das Wort Synagoge ist eigentlich griechischen Ursprungs und heißt so viel wie Versammlung. Auch ist es nicht die einzige Bezeichnung für die Räumlichkeiten, in denen Jüdinnen und Juden zusammenkommen, um gemeinsam den Schabbat oder die Feiertage einzuleiten. In Israel heißt es Beit haKnesset (hebr. Haus der Versammlung), in den Vereinigten Staaten ist ebenfalls der Begriff Tempel üblich und im Jiddischen spricht man eher von der „Shul“. Eine Synagoge selbst kann nie heilig sein, sehr wohl dagegen die Gegenstände, die sich in ihr befinden – allen voran die von Hand geschriebenen Torah-Rollen, also den Fünf Büchern Moses, die wiederum zwischen zwei größere Holzstäbe aufgewickelt werden, welche auch „Etz Hachaim“ (hebr. Baum des Lebens) heißen.
In der rabbinischen Literatur sind Synagogen unbekannt, weshalb sie wohl erst mit der Zerstörung des Zweiten Tempels durch die Römer an Bedeutung gewannen. Zugleich markieren sie den Übergang von einem Ritual, das wie in Jerusalem mit Opfern verbunden war, zu einem Gottesdienst, der sich ausschließlich auf Texte bezieht und zudem völlig ortsunabhängig stattfinden kann. Auch gibt es kein einheitlicher Baustil. Die Architektur einer Synagoge kann deshalb abhängig von dem jeweiligen Geschmack einer Epoche oder Region sein, zudem sind so ziemlich alle Baumaterialien erlaubt. Wohl aber kennen alle den Torah-Schrein, bei sephardischen Juden „Heichal“ (hebr. Palast) und bei aschkenasischen Juden „Aron Hakodesch“ (hebr. heiliger Schrein) genannt, der sich immer an der Ostwand einer Synagoge befindet. Auch eine „Bima“, (hebr. Bühne), eine leicht erhöhtes Pult, worauf die Torah-Rolle zur Lesung gelegt wird, und ein kleines, rund um die Uhr brennendes Licht und das „Ner Tamid“ (hebr. Immerwährendes Licht) sowie ein Becken mit Wasser zum Waschen der Hände gehören zur Grundausstattung.
Um einen Gottesdienst abhalten zu können, sind mindestens zehn religiös mündige Männer notwendig, dem „Minjan“ bezeichneten Quorum an Betern. Ein Rabbiner muss dafür übrigens nicht unbedingt zwingend anwesend sein. Er hat ohnehin eher eine beratende Funktion und soll dafür sorgen, dass eine Gemeinde möglichst im Einklang mit den 613 Mitzwot, den Ge- und Verboten, lebt. Dafür ist er für die Predigten zuständig. Parallel dazu ist in der Synagoge noch der Vorbeter, auch Chasan oder Kantor genannt, tätig, der gleichfalls bestens mit der Liturgie vertraut sein sollte. Frauen und Männer sitzen in Synagogen getrennt – zumindest in der Orthodoxie. In der konservativen und reformorientierten Ausrichtung dagegen ist dies nicht mehr der Fall. In einem solchen „egalitären Minjan“ reichen bereits zehn Gemeindemitglieder beiderlei Geschlechts für einen Gottesdienst aus und Rabbinerinnen sowie Kantorinnen sind etwas völlig Normales.
Mikwe
Für Frauen zählt der Gang zur „Mikwe“, dem Ritualbad, ebenfalls zu einer religiösen Pflicht im Alltag. Dieses mindestens 500 Liter fassende Becken befindet sich zumeist in unmittelbarer Nähe einer Synagoge, wird entweder mit fließendem Quell- oder Flusswasser oder auch mit Regenwasser gespeist und sollte sieben Stufen haben. In der Orthodoxie, aber ebenfalls im konservativen Judentum ist das Bad in der Mikwe nach der Menstruation obligatorisch, wobei der Körper frei von jeglicher Bekleidung oder Schmuck sein sollte. In der reformorientierten Ausrichtung sieht man das etwas weniger streng, weshalb die wenigsten Frauen sich diesem Prozedere unterziehen. Das Eintauchen des gesamten Körpers ist aber nach einem „Giur“, der Konversion zum Judentum, in allen drei Strömungen des Judentums gleich vorgeschrieben – sowohl für Frauen als auch für Männer. Und in manchen Gruppierungen innerhalb der Orthodoxie steigen Männer ebenfalls in das Ritualbad, und zwar vor Beginn des Schabbats oder hohen Feiertagen, allen voran Yom Kippur.

–> Taharah, Tumah und Mikwa – Erläuterungen im Kontext ritueller Reinheitsgebote
Schabbat
Der siebte Tag in der Woche ist ein Ruhetag – das jedenfalls schreibt eines der Zehn Gebote vor, was bereits die Wichtigkeit des Schabbats unterstreicht. Dieser beginnt mit dem Sonnenuntergang am Freitag sobald es dunkel wird, dem „Erev“ (hebr. Abend), und endet am Samstagabend mit der „Hawdala“ (hebr. Unterscheidung, Trennung), wenn drei mittlere Sterne wieder sichtbar sind, woraufhin auch eine neue Woche beginnt. Der Gottesdienst am Freitag in der Synagoge fängt eine Stunde vor Sonnenuntergang mit einer Kabbalat Schabbat (hebr. Empfang des Schabbats) an, wobei der Schabbat selbst in Liturgie mit einer Braut verglichen wird, die dann von den Betenden freudig begrüßt wird. Vorgetragen wird ebenfalls ein Textabschnitt aus der Torah, der „Paraschat Haschawua“ (hebr. Wochenabschnitt), so dass man innerhalb eines Jahres die gesamte Torah von Anfang bis Ende gelesen hat. Nach dem Gottesdienst wünschen sich alle seine Besucher gegenseitig „Schabbat Schalom“, einen möglichst friedvollen und ruhigen Schabbat.
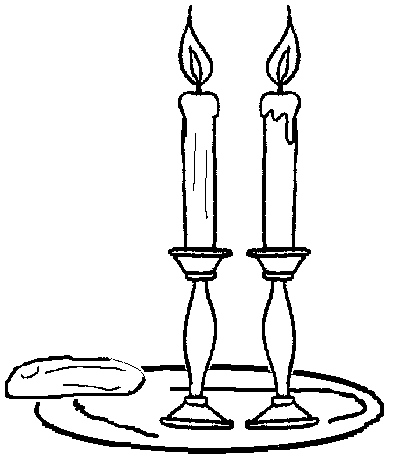 Zugleich wird der Schabbat traditionell auch im Kreis der Familie begangen. Die Frau des Hauses, die in der Orthodoxie oftmals nichtan der Kabbalat Schabbat in der Synagoge teilnimmt, weil sie mit den Vorbereitungen für den häuslichen Teil des Schabbats verantwortlich ist, entzündet kurz vor Sonnenuntergang die beiden Schabbatkerzen, während der Mann vor dem Essen das Kiddusch, den Segen über das Brot – zumeist ein als Challa bezeichneter Hefezopf – und den Wein spricht. Darüber hinaus werden im Verlauf der Zeit bis zum Samstagabend Speisen serviert, die es zumeist nur an diesem Tag gibt, beispielsweise Tscholent, ein unter aschkenasischen Juden beliebtes Fleisch- und Bohnengericht, das bereits vor Schabbat zubereitet und dann über viele Stunden hinweg warm gehalten wird.
Zugleich wird der Schabbat traditionell auch im Kreis der Familie begangen. Die Frau des Hauses, die in der Orthodoxie oftmals nichtan der Kabbalat Schabbat in der Synagoge teilnimmt, weil sie mit den Vorbereitungen für den häuslichen Teil des Schabbats verantwortlich ist, entzündet kurz vor Sonnenuntergang die beiden Schabbatkerzen, während der Mann vor dem Essen das Kiddusch, den Segen über das Brot – zumeist ein als Challa bezeichneter Hefezopf – und den Wein spricht. Darüber hinaus werden im Verlauf der Zeit bis zum Samstagabend Speisen serviert, die es zumeist nur an diesem Tag gibt, beispielsweise Tscholent, ein unter aschkenasischen Juden beliebtes Fleisch- und Bohnengericht, das bereits vor Schabbat zubereitet und dann über viele Stunden hinweg warm gehalten wird.
Denn der Schabbat ist ein Ruhetag, an dem keinerlei Tätigkeit nachgegangen werden soll, wobei der Halacha genau 39 Arten von Arbeit auflistet, die zu unterlassen sind. Konkret bedeutet dies, dass man in dieser Zeit weder körperlich aktiv soll, noch Geschäfte abschließt. Auch darf kein Feuer nach Beginn des Schabbats entfacht werden, weder in der Synagoge, noch in den eigenen vier Wänden. Das hat in der Neuzeit zu zahlreichen Diskussionen darüber geführt, inwieweit die Vorschriften gleichfalls für den Gebrauch von Elektrizität gelten. Als allseits bewährte Kompromisslösung hat sich der Schabbat-Modus bei manchen Geräten bewährt, der es vor allem orthodoxen Juden erlaubt, einige Bequemlichkeiten in Anspruch zu nehmen, ohne gleich gegen ein Verbot zu verstoßen. Unter anderem gibt es Fahrstühle, die so eingestellt werden, dass sie zwischen Freitag- und Samstagabend automatisch auf jeder Etage halten und ihre Türen sich öffnen. Jüdinnen und Juden, die sich eher der konservativen oder reformorientierten Strömungen verbunden fühlen, sehen das nicht ganz so streng mit den Vorschriften – auch wenn ihnen der Schabbat natürlich weiterhin heilig ist. Die Nutzung eines Autos für den Besuch in der Synagoge stellt für sie kein Problem dar.
–> Was und warum wird überhaupt am Schabbat gefeiert?
–> Gedanken zum Schabbat
–> Der Schabbat und die Arbeit: Awoda und Malacha
 Kaschrut
Kaschrut
Die auch als Kaschrut bezeichneten jüdischen Speisegesetze nennen all das, was „koscher“ (hebr. tauglich, rein) ist, und verweisen auf solche Gerichte, von denen man besser die Finger lässt, weil sie als „treife“ (hebr. rituell unrein) gelten, weshalb ihr Verzehr untersagt ist. Um zu wissen, ob ein Tier koscher ist oder nicht, reicht die grobe Faustregel, dass es domestiziert sein sollte, zweigespaltene Hufe aufweist oder ein Wiederkäuer ist. Rinder, Schafe oder Ziegen und Hühner fallen unter diese Rubrik, während Pferde, Hasen oder Schweine nie koscher sein können. Doch auf den Teller darf ein solches Tier nur dann, wenn es auch rituell geschlachtet, also geschächtet, wurde. Denn der Genuss von Blut ist ein Tabu. „Die Lebenskraft des Fleisches sitzt im Blut, heißt es in den Heiligen Schriften, weshalb das Tier vorher ausbluten muss. Und bei allem, was aus dem Meer kommt, gilt: Fische sollten Schuppen haben, um sie verzehren zu dürfen. Garnelen, Aal oder Hummer sind deshalb ebenfalls nicht koscher. Unterschieden wird ferner zwischen fleischigen und milchigen Zutaten, die man auf keinen Fall vermischen darf. Diese Regel bezieht sich auf das Gebot; „Du sollst ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen“. Ein Cheeseburger darf demnach nicht auf der Speisekarte stehen.
Im Alltag kann die Einhaltung der Kaschrut schon mal einige Probleme mit sich bringen, vor allem dann, wenn man als Jüdin oder Jude in einer mehrheitlich nichtjüdischen Umwelt lebt, die diese Regeln eben nicht kennt. Das beginnt bei der Beschaffung von Lebensmittel, die entsprechend als „koscher“ gekennzeichnet sind, und kann ebenfalls einen Restaurantbesuch problematisch gestalten, weil sich so schnell keines findet, das Kaschrut-konform geführt wird, also unter anderem am Schabbat geschlossen bleibt. Aber auch ein sehr traditionell geführter Haushalt kann eine Wissenschaft für sich sein, weil angefangen von den Spülbecken in der Küche bis hin zu den Tellern und dem Besteck alles doppelt vorhanden sein muss, und zwar einmal für fleischige und einmal für milchige Speisen. Wer es sehr streng nimmt mit den Vorschriften, hat sogar eine dritte Küche, und zwar eigens für die Pessach-Tage, an denen der Genuss von jeder Form von „Chametz (hebr. Gesäuertes), womit Brot, Bier oder Pasta gemeint sind, untersagt ist.
Zentralität Israels
Juden in aller Welt haben zum Staat Israel ein besonderes Verhältnis. In Israel befinden sich viele der Orte, die allen Juden aus den Heiligen Schriften sehr vertraut sind. Das beginnt mit der Stadt Jerusalem, die in der Torah einige hundert Mal erwähnt wird, sowie der Klagemauer, den Resten der Fundamente des Zweiten Tempels, und hört mit dem Grab der Patriarchen bei Hebron, in dem laut „Tanach“ die Erzeltern der Israeliten, also Abraham und Sara sowie Isaak und Rebekka, bestattet worden sind, auf. Aber die Region zwischen Jordan und Mittelmeer ist nicht nur der Schauplatz vieler Ereignisse, die vor einigen Tausend Jahren stattfanden, sondern ebenfalls ein Ort, dem man sich emotional, religiös oder auch spirituell eng verbunden fühlt. „Nächstes Jahr in Jerusalem“, lautet beispielsweise ein traditioneller Wunsch, den man am Ende des Sederabend an Pessach sagt. Außerdem wird seit vielen Generationen überall auf der Welt Richtung Jerusalem gebetet.

Aus dieser spirituellen Verbundenheit wird Jüdinnen und Juden auch von außen eine Verbindung zugesprochen, indem sie immer wieder offen oder ganz subtil dafür verantwortlich gemacht, was in „ihrem Land“ gerade geschehen würde, womit dann Israel gemeint ist. Auf diese Weise schwingt eine Wahrnehmung durch, die Juden als deutsche Staatsbürger entweder nicht wirklich anerkennt oder ihnen – auch das ist ein altes antisemitisches Stereotyp – eine gewisse Doppelloyalität unterstellt. Deutsche Jüdinnen und Juden werden im Alltag so oftmals dazu gezwungen, eine Position zu den Ereignissen im Nahen Osten zu beziehen – ob sie es wollen oder nicht.
In diesem Zusammenhang erfüllt Israel aber gleichzeitig eine weitere Funktion. Für Jüdinnen und Juden in der Diaspora ist der jüdische Staat eine Art Lebensversicherung. Zu oft hat es sich in der Geschichte gezeigt, dass ihnen in bestimmten gesellschaftlichen oder politischen Konstellationen Gefahr droht und sie dann fliehen mussten. Das Wissen um die Option, in einem solchen Fall in Israel Zuflucht und gegebenenfalls eine neue Bleibe finden zu können, ist gerade vor diesem Hintergrund der Erfahrungen, die Juden in den Jahren zwischen 1933 und 1945 machen mussten, enorm wichtig. Dabei war das Verhältnis zwischen Juden, die sich im Nachkriegsdeutschland niederließen, und Israel anfangs kein einfaches. Oftmals wurde ihnen zum Vorwurf gemacht, dass sie ausgerechnet im Land der Täter lebten. Umgekehrt betrachteten viele Juden ihre Existenz in Deutschland nur als eine provisorische, weshalb man „auf gepackten Koffern“ sitzen würde, also eine Auswanderung nach Israel nur eine Frage der Zeit sei. Doch mittlerweile hat sich dies alles entspannt. Juden in Deutschland werden aus israelischer Perspektive als eine von vielen Diaspora-Gemeinschaften betrachtet und die jüdische Gemeinschaft hierzulande hat ein enges und äußerst vielschichtiges Verhältnis zu Israel aufgebaut.
