Von Iris Noah
„… aber das Alte Testament haben wir mit den Juden gemeinsam“: So könnte man den Konsens quer durch das christliche Lager auf den Punkt bringen. Doch halt – das stimmt nur zum Teil. Was Juden und Christen trennt, ist das Neue Testament, das Verständnis der Person Jesu aber auch die Unterschiedlichkeit im Umgang mit dem, was Christen „Altes Testament“ und Juden “ TaNaCh“ nennen.
Tanach ist ein Akronym, das aus den Anfangsbuchstaben für die drei Worte Torah, Newiim und Ketuvim gebildet ist.
Die Torah besteht aus den 5 Mosebüchern, die in der hebräischen Bibel jeweils nach einem der ersten Worte des jeweiligen Buches heißen: beReschith (im Anfang), Schemoth (die Namen), vajikra (Er rief), baMidbar (in der Wüste) sowie Dewarim (Reden).
Zu den Newiim, den prophetischen Büchern, gehören nicht nur – wie in der christlichen Tradition – die drei großen Propheten Jesaja, Jeremia und Hesekiel sowie die zwölf „kleinen“ Propheten, sondern es gehen ihnen die „ersten Propheten“ voran, nämlich: Josua, Richter, 1 + 2. Samuel sowie 1. + 2. Könige.
Die Khetuwim, die sonstigen Schriften, umfassen die Psalmen, die Sprüche Salomons, Hiob, das Hohelied, Rut, Klagelieder, Prediger Salomo, Ester, Daniel, Esra, Nehemia sowie 1 + 2. Chronik.
Am Sinai hat Moscheh (Moses) von G’tt die Torah erhalten, wobei im Hebräischen die Mehrzahlform „Toroth“ steht. In der Sifra Bechukkotaj heißt es kommentierend dazu: „Warum wird Toroth im Plural gesagt und nicht Torah im Singular? Um uns zu lehren, daß dem Volk Israel zweimal Torah gegeben ist: eine geschriebene und eine mündliche.“
Nach jüdischem Verständnis wurde die mündliche Lehre von Moses über Generationen hinweg weitergegeben und fand erst zu einem späteren Zeitpunkt ihre schriftliche Fassung. Als der Tempel zum zweiten Mal zerstört wurde (70 n.d.Z.) und das Land von den Römern besetzt war, stellte sich die Frage, wie das Judentum nach diesem Ereignis und der Zerstreuung in die Völker überlebensfähig bleiben könnte. Nach langen Diskussionen begann dann ein Prozeß der Verschriftung der ursprünglich mündlichen Lehre. Diese mündliche Lehre ist der Talmud. „Einzig die durch den Talmud erhellte Bibel schreibt den Leser in eine jüdische Lektüre der Schriften ein“, so drückt es der französische Rabbiner und Philosophieprofessor Marc-Alain Ouaknin aus.
Der Talmud ist also die Brille, durch die Juden die Torah lernen und interpretieren. Ein Beispiel: In der Torah heißt es: „Sechs Tage darf Arbeit verrichtet werden, aber am siebenten Tag ist ein Schabbat vollkommener Ruhe, heilige Berufung, keinerlei Arbeit dürft ihr verrichten; ein Schabbat ist es dem Ewigen an allen euren Wohnsitzen“ (3 Mose 23,3). Wie nun ist diese Ordnung G’ttes zu verstehen? Wann genau beginnt der Schabbat und wann endet er? Was ist Arbeit und was nicht? Wo liegen die Grenzen? Welche Strecken dürfen zurückgelegt werden? Was passiert, wenn die Kuh des Nachbarn gerade am Schabbat in eine Grube fällt? Diese und andere Fragestellungen werden in der schriftlichen Torah nicht beantwortet. Sie werden aber von den Weisen diskutiert und in ihrer Unterschiedlichkeit festgehalten: Rabbi X sagt das, Rabbi Y fügt jenes dazu und Rabbi Z meint wieder etwas anderes. Immer haben auch Minderheitspositionen Platz.
Im Talmud schlagen sich Meinungen und Diskussionen von nahezu 3000 Lehrern aus mehr als sieben Jahrhunderten und drei Kontinenten nieder: eine Diskussion über Grenzen von Zeit und Raum hinweg. Weil Juden in unterschiedlichen Zeiten und zu unterschiedlichen Bedingungen in den verschiedensten Umweltkulturen leben, besteht immer wieder die Notwendigkeit, zu fragen, wie Wort G’ttes in der jeweilige Zeit hinein aktualisiert wird, denn es geht nicht um ein passives Aufnehmen der Tradition, sondern um ein immer neues Ringen und Umsetzen der Weisung G’ttes.
Der Talmud setzt sich aus 2 Teilen zusammen: Die Mischnah (wörtlich Lehre) ist der älteste und stellt den Text im eigentlichen Sinn dar. Sie umfasst alle Lebensbereiche. Dahinter steht die Frage, wie in einer Welt, die von G’tt und auf ihn hin geschaffen ist das Handeln der Menschen aussehen soll, so dass es das Wesen und die Absichten G’ttes repräsentiert. Die Gemarah wiederum ist die Diskussion und der Kommentar zur Mischna. Hieraus wird schon deutlich, dass das Leben sich immer wieder wandelt und diesem Wandel auch in der Diskussion und Lebenspraxis Rechnung getragen werden soll. An der Mischna haben mehrere Generationen von Gelehrten gearbeitet. Ende des 2. Jahrhunderts wurde sie von Rabbi Jehuda Hanasi redigiert und gegliedert: Nämlich in 6 Ordnungen zu 63 Traktaten mit 524 Kapiteln.
Zu den Mischna-Texten gibt es zwei verschiedene Gemara-Fassungen: die eine ist die Gemara von Jerusalem von Meistern aus den Schulen auf israelischem Gebiet, die andere ist die Gemara von Babylon, in der sich die Erkenntnisse von Rabbinen aus den Schulen von Babylon niederschlagen. Man spricht deshalb vom palästinensischen oder vom babylonischen Talmud. Wenn nichts anderes vermerkt ist, bezieht sich Fachliteratur auf den wesentlich umfangreicheren babylonischen Talmud.
Wer heute eine Talmudseite vor sich hat, findet in der Mitte eine Kolumne angeordnet, in der sich Mischna- und Gemaratext abwechseln jeweils durch ° voneinander abgesetzt. Umrahmt wird diese Kolumne von zwei späteren Kommentaren: Auf der Seite, die zur Buchmitte liegt, steht der Kommentar von Raschi (1040 -1105), einer der größten jüdischen Gelehrten. Geboren im französischen Troyes verbrachte er einen Großteil seines Lebens in Mainz. Sein Kommentar ist der Kommentar zum Talmud schlechthin: Er folgt Schritt für Schritt jedem Talmudsatz, erläutert schwierige Worte und stellt Bezüge zu anderen Texten her.
Auf dem äußeren Rand der (Buch-)Seite befinden sich die Kommentare der Tossafot (wörtlich: Zusätze). Die Tossafisten sind Schüler von Raschi. Sie lebten im 12. und 13. Jahrhundert in Deutschland, Frankreich und England. Ihr Stil unterscheidet sich völlig von Raschi. Es liegt ihnen nicht an einem fortlaufenden Kommentar, sondern sie greifen die schwierigen Stellen eines Textes heraus, vergleichen mit anderen Stellen und benennen dann Widersprüche, die sie dann zu lösen versuchen. Sie beziehen sich oft auf Raschi und zeigen auf, wo der Kommentar von Raschi Schwierigkeiten zeigt. Bestimmte Talmud-Traktate sind von Raschi nicht vollständig kommentiert. Diese Lücken füllen die Tossafisten.
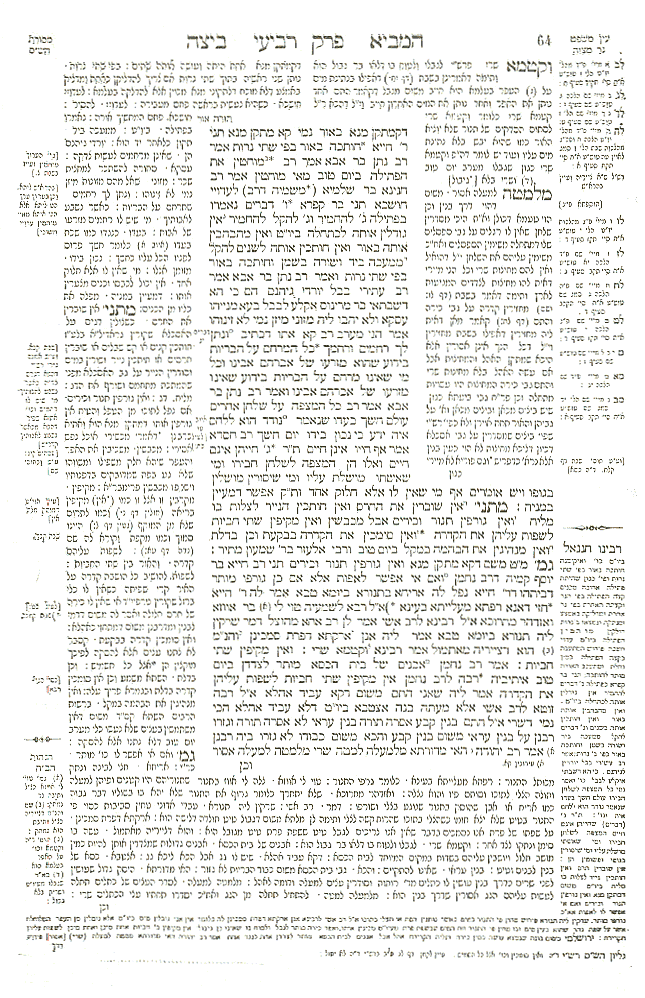
Welche Rolle, könnte nun der Talmud, die mündliche Torah, im christl.-jüd. Gespräch einnehmen? Was haben Christen unserer Tage davon, wenn sie sich mit dem Talmud beschäftigen?
Jesus hat als Jude in der jüdischen Tradition gelebt. Wer die Lebenswelt Jesu und den geistigen Horizont dieser Epoche nicht nur oberflächlich kennenlernen will, kommt um den Talmud nicht herum. Das Christentum ist auf diesem geistigen Hintergrund entstanden. Immer wieder bezieht sich Jesus auf Diskussionen seiner Zeit, die sich sowohl im Talmud als auch im Neuen Testament niederschlagen. „Die Schriftdeutung Jesus unterscheidet sich kaum von jener der übrigen Interpreten aus jener Epoche. Gelegentlich äußert er einen neuen Gedanken, doch sind seine Postulate nicht radikal anders“ schreibt Rabbiner Roland Gradwohl. Wenn es um den Umgang mit Armen geht, so sagt Jesus „Du aber, wenn du Wohltätigkeit übst (Z’dakah), dann laß nicht einmal deine Linke wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei“ (vgl. Mt 6,1-3). Der Talmud sagt: „Wer Almosen im Verborgenen gibt, ist größer als Moses, unser Lehrer“ und es ist wichtig, daß „der Geber nicht weiß, wem er gibt und der Empfänger nicht weiß, von wem er die Gabe bekommt“.
Auf die Frage, was das Wesentliche der Torah sei, antwortet Hillel, der eine Generation vor Jesus lebte: „Was dir nicht lieb ist, füge dem Nächsten nicht an. Das ist die Torah, alles Übrige ist nur Ausführung“ (Traktat Schabbat). Jesus antwortet auf dieselbe Frage: „Tue deinem Nächsten so, wie du behandelt werden willst“ (goldene Regel). Der Unterschied besteht darin, dass Jesus von einem Juden und Hillel, der ein Pharisäer war, von einem Heiden gefragt wurde.
Wer den Talmud kennenlernt merkt, dass Jesus keiner der Gruppierungen seiner Zeit inhaltlich so nahesteht wie gerade den Pharisäern. Manche jüdischen Theologen ordnen ihn deshalb dieser Richtung zu. Warum aber sind gerade die Pharisäer in der christlichen Tradition zum negativen Stereotyp schlechthin verkommen? Ohne zu differenzieren werden sie als gesetzlich und heuchlerisch beschrieben und diese Sicht wurde von christlicher Seite auf die Juden pauschal erweitert. Sie bereitete den Nährboden für christlichen Antijudaismus.
Um eine erweiterte Sicht zu bekommen, ist ein Blick in den Talmud hilfreich. Schon der palästinensische Talmud benennt sieben Sorten von Pharisäern. Die Kritik Jesu an (einzelnen) Pharisäern stimmt mit der dortigen Kritik überein. Jesus hat Auswüchse pharisäischen Lebensstils kritisiert, niemals aber die Pharisäer pauschal als Gruppe. Nach der Zerstörung Jerusalems durch römische Truppen (70 n.d.Z.) waren es die Pharisäer, welche die jüdische Tradition bewahrten, weitergaben und auf die Notwendigkeit hinwiesen, daß sie in jeder Epoche neu interpretiert werden muss und so eine Erstarrung in geronnene und leblose Traditionen verhindert wird.
