
Jehudah haLevis „Buch des Beweises und Argumentes zur Vertheidigung des gering geschätzten Glaubens“
Jehuda Halevi verfaßte um 1140 das religionsphilosophische Werk »Kuzari«. Seiner äußeren Form nach behandelt das Buch die Bekehrung eines Chazarenkönigs (des Königs von »Kuzar«) zum Judentum. Den an seiner bisherigen Religion zweifelnden Fürsten suchen, wie die Einleitung kurz darstellt, ein Philosoph, ein christlicher und ein mohammedanischer Gelehrter vergebens von der Wahrheit ihres religiösen Standpunktes zu überzeugen. Dies gelingt erst dem an letzter Stelle zu ihm berufenen Lehrer des Judentums, der in eingehenden Gesprächen den Inhalt der jüdischen Lehre entwickelt.
Der außerordentlich glücklich gewählte inhaltliche Rahmen gibt die Möglichkeit, das Judentum gegen alle damals mit ihm rivalisierenden geistigen Mächte, die positiven Religionen, Christentum und Islam, wie die Vernunftreligion der Philosophen zur Geltung bringen.
Der Nachdruck der Polemik des Buches liegt im Kampf gegen jene Übergriffe der Philosophie auf das religiöse Gebiet, die nach der Darstellung Jehudah haLevis zu vollkommener Gleichgültigkeit gegen alle positive Religion und zur Entstehung einer Vernunftreligion geführt haben, die in der philosophischen Gotteserkenntnis den wahren Weg zur Gemeinschaft mit Gott sieht, Jehudah haLevi bekämpft nicht die Wissenschaft als solche, deren mathematische und naturwissenschaftliche Leistung er vielmehr voll anerkennt, sein Kampf richtet sich nur gegen die Metaphysik, die er im Anschluss an Ghasali, wenigstens in ihrer geschichtlich vorliegenden Gestalt, als eine Scheinwissenschaft zu deuten sucht. Die Gewissheit der Religion ist nach ihm nicht durch philosophische Argumentationen zu begründen; sie ruht auf dem sicheren Grunde der geschichtlich beglaubigten Offenbarung. Der Sinn der Religion ist für ihn nicht ein bloßes Wissen von Gott, sondern eine lebendige Gemeinschaft der Seele mit Gott. Das psychologische Organ zu ihr aber ist nicht, wie die Philosophen lehren, der Intellekt, sondern eine eigene »göttliche Kraft« der Seele, die nur Israel verliehen ist. Sie ist außerdem nur möglich, wo Gott selbst eine solche Gemeinschaft stiftet; das Judentum ist nicht nur die allein wahre, sondern die allein wirkliche Religion, d.h. die einzige, in der eine wirkliche Gemeinschaft Gottes mit den Menschen besteht. Diese Gemeinschaft wird freilich in äußerlich-dinglicher Form beschrieben, an Naturbedingungen und an bestimmte zeremoniale und kultische Handlungen geknüpft. Aber es ist doch die Besonderheit des religiösen Verhaltens gegenüber der theoretischen Erkenntnis tief und innerlich begriffen.
Zur Abwehr gegen philosophische Angriffe hält Jehudah haLevi aber auch eine gedankliche Behandlung der religiösen Fragen für zulässig, die den Nachweis zu erbringen hat, dass die Religion nichts Vernunftwidriges lehrt. Von diesem Standpunkt aus behandelt er eine Reihe religionsphilosophischer Einzelfragen, mit besonderer Ausführlichkeit die Lehre von den Eigenschaften Gottes und schließt sich hier den herrschenden philosophischen Ansichten wesentlich näher an, als seine grundsätzliche Kritik der Metaphysik vermuten lässt. Selbst seine Lehre von der »göttlichen Kraft« der Seele, die sie zur Gemeinschaft mit Gott befähigt, und von den Bedingungen, die diese Anlage zur Entfaltung bringen, ist ganz nach dem allgemeinen philosophischen Schema konzipiert, nach dem die Materie jeweils die höchste Form in sich aufnimmt, zu deren Aufnahme sie durch ihre Disposition und die diese fördernden äußeren Bedingungen befähigt ist.
Al_chazari wurde im Jahr 2000 bei Fourier und später bei Marix verlegt.
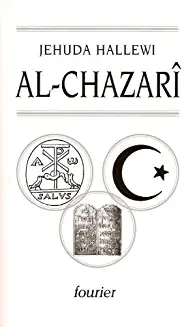 JEHUDA HALLEWI: AL-CHAZARÌ
JEHUDA HALLEWI: AL-CHAZARÌ
Das Buch des Beweises und Argumentes zur Vertheidigung des gering geschätzten Glaubens
Über das Buch Al-Chazari, aus einem Vorwort des Übersetzers Dr. Hartwig Hirschfeld (1885)
Das Buch Al-Chazari trägt den Stempel einer Streitschrift und nimmt durch Alter sowohl als durch Inhalt und Bedeutung in der mittelalterlich-philosophischen und im engeren Sinne polemischen Literatur der Juden einen hervorragenden Platz ein. Denn abgesehen von seinem Inhalt weist darauf schon sein arabischer Titel hin, welcher lautet: „Buch des Beweises und Argumentes zur Vertheidigung des gering geschätzten Glaubens“.
Seine Abfassungsfrist fällt, nach des Verfassers eigener Angabe auf das Jahr 1140 unserer Zeitrechnung. Etwa 30 Jahre nach seiner Entstehung wurde es von Jehuda IbnTibbon, dem ersten aus jener berühmten, um die Übersetzungsliteratur so verdienten Familie ins Hebräische übersetzt, und in dieser Gestalt liegt das Buch für den allgemeinen unmittelbaren Gebrauch bis jetzt vor.
Eingebürgert hat sich der Titel „Sefer haKusari“, im Original jedoch eher „Al-Chasari“. Manchmal heisst es auch „Sefer Sangari“, wobei der Name des Isak Sangari*, welcher dem disputierenden Rabbi gegeben wird, weder im arabischen Original, noch in den Handschriften, noch gar in den ältesten Druckausgaben der hebräischen Übersetzung auftaucht, sondern erst in der Ausgabe Muscatos (Venedig 1594).
*) Es dürfte schwerlich von absoluter Wichtigkeit sein zu erforschen, auf welche Weise dieser Name sich in den Titel des Buches verirrt hat. Zwar hat Carmoly bereits das Richtige getroffen, wenn er den Namen auf die Stadt Sindjar in Mesopotamien bezieht, aber er selbst konnte sich noch nicht von dem Gedanken los machen, dass dieser R. lsak aus Sindjar wirklich der Lehrer des Cbazarenkönigs gewesen sei. Es lässt sich aber in keiner Weise sagen, wieso dieser Mann sich zum Disputator mit dem Könige gemacht hat oder von anderen dazu gemacht worden ist. Die geschichtlichen Quellen liefern hierfür keinen Anhalt, und es bleibt kaum etwas anderes übrig, als den Namen völlig bei Seite zu setzen, bis sich von irgend woher eine geschichtliche Deutung auftreiben lässt.
Ob nun Kusari, haKusari, Chasari oder Al-Chasari, der einzig richtige Titel des Buches ist eben der, den der Verfasser selbst zur Bezeichnung des Inhaltes und der Absicht seines Buches gewählt hat: „Buch des Beweises und Argumentes zur Vertheidigung des gering geschätzten Glaubens“. Aber er hat anscheinend darin einen zu scharfen Ausdruck gebraucht, wenn er seinen Glauben einen geringgeschätzten nennt. Denn in der That drückt diese Verdeutschung sich nicht genau mit dem entsprechenden arabischen Originalworte al-dalil, welches „niedrig, gemein“ bedeutet. Der Verfasser hat es aber ohne Zweifel in der Absicht gewählt, dass es, zumal es zugleich den bei arabischen Büchertiteln üblichen Reim — auf al-dalil — gibt, objektiv, als eine von der zeitgenössischen öffentlichen Meinung oder tatsächlich aufgetretenen Gegnern auf seinen Glauben angewendete Bezeichnung aufgefasst werde.
Die allgemeine Verkörperung dieser Gegner bildet zunächst der Chazarenkönig selbst, dem der Verfasser alles dasjenige in den Mund legt, was die Gegner des Judentums, insbesondere des rabbanitischen zu allen Zeiten auf der Zunge zu führen pflegten. Denn da der König den Philosophen abtreten lässt, entschließt er sich, Christen und Muslime zu befragen, „was aber, fährt er fort, die Juden anbetrifft, so genügt mir, was von ihrer Niedrigkeit, Geringzahl und dem allgemeinen Hasse gegen sie bekannt ist“. (I.4. S.6) Er scheut sich sogar nicht, dies vor dem endlich doch herbei gerufenen Juden offen auszusprechen, „dass er eigentlich nicht die Absicht gehabt habe, einen Juden zu fragen, weil er ihren heruntergekommenen Zustand und ihre mangelhafte Urteilsfähigkeit kenne; denn das Elend habe ihnen nichts Rühmenswertes übrig gelassen“. (I.12. S. 11).
Demgemäß ist der Ton, den er dem Rabbi gegenüber anzuschlagen für gut findet, ein unverhohlen geringschätziger, der sich erst im Laufe der Unterhaltung allmählich bessert, nachdem jener sich gewissermaßen die Möglichkeit erzwingen musste, den König über seine ersten Worte zu belehren (I.17). Auf diese geringschätzenden Äußerungen gibt der Rabbi dem Könige fürs Erste auch keine Antwort, sondern verhält sich abwartend, nur mit dem Gegenstande der ersten Frage des Königs beschäftigt. Es steht sogar nach einer längeren Unterhaltung darüber noch nicht einmal fest, ob sie länger beisammen bleiben werden (I.68, S. 21). Erst nachdem der Rabbi seinen königlichen Zuhörer, immer an dessen erste Frage anknüpfend, von der göttlichen Unfehlbarkeit des israelitischen Glaubens überzeugt hat, der lediglich auf den geschichtlichen Tatsachen der Rettung des Volkes und der direkten Offenbarung beruhe, jener aber von neuem auf die demnach nicht zu erwartende äußere Niedrigkeit der Juden zurückkommt, greift er auf dessen erste Bemerkungen zurück und sagt (I.113, S.40): „Ich sehe, wie du uns Niedrigkeit und Armut zum Vorwurf machst, während mit beidem die Besten jener Völker (gemeint sind Christen und Muslime) sich rühmen“. Da der König ihm aber darauf entgegenhält, dass die jüdische Demut doch keine freiwillige sei, wie sie der Stifter des christlichen Glaubens vorgeschrieben habe, entgegnet er, dass es jedem Juden frei stehe, „in jedem Augenblick durch ein ausgesprochenes Wort Niedrigkeit und Verachtung von sich zu werfen“. (I.115)
Die in dem Buche offenbarte Polemik ist, soweit sie es mit anderen Glaubensformen zu tun hat, durchaus verteidigend und wirkt Bedeutendes schon durch die Vornehmheit und Urbanität der Sprache.
Immer wieder betont er die auf geschichtlichen Tatsachen beruhende Überlieferung. So gibt er auch gleich zu Anfang einen direkten Hinweis auf die Bedeutung der Tradition, indem er den disputierenden Rabbi sich auf den Auszug aus Ägypten beziehen lässt, für welchen er sich nur auf eine Menge von Augenzeugen berufen kann und muss. „Ich habe dir geantwortet, sagt er, wie ich musste und wie ganz Israel muss, das heisst erst durch eigene Anschauung, dann durch die ununterbrochene Überlieferung – welche der Anschauung gleichkommt“ (I.25).
Diese ist die wesentliche Grundlage, auf welcher der Rabbi seine ganze folgende Auseinandersetzung aufbaut. Nach dem Auszüge aus Ägypten waren nur die Ausgezogenen berechtigt und verpflichtet, das Gesetz auf sich zu nehmen (I.21), der Glaube an das. was vorher gewesen ist, an die Schöpfung, die Verheißungen ergebe sich dann von selbst auf Grund der Überlieferung seit Adam (I.43. II.80. S.63), woraus sich sogar die Anzahl der verflossenen Jahre berechnen lasse (I.47). Zu den folgenden Paragraphen werden diese Behauptungen dann weiter ausgeführt…
Soweit nach dem Vorwort von Dr. Hartwig Hirschfeld, dessen Verdeutschung aus dem arabischen Original des Abu al-Hasan Jehudah haLevi 1885 in Breslau erschienen ist.
Wie bei vielen Verteidigungsschriften handelt es sich auch beim Kusari um ein nicht nur um die Aufklärung von Nichtjuden bemühtes Werk, sondern auch um ein, insbesondere in seiner religiösen Argumentation grundlegendes Werk der innerjüdischen Bildung.
Im Falle des Kusari geht es Jehudah haLevi (1075 -1141, Tudela) immer wieder um die Verteidigung der talmudischen Überlieferung gegen philosophische Spekulation. Eine Spannung um deren Ausgleich sich der RaMBaM (1138, Córdoba – 1204, Kairo) so entschlossen einsetzte.
Für haLevi ist klar, dass nur der die talmudische Überlieferung anfeindet, „der sie nicht kennt und sich nicht die Mühe gegeben hat, sie zu lesen und zu durchforschen, der von den Reden der Weisen nur allgemeine und allegorisierende Sprüche gehört hat und dann ein ebenso hinfälliges als mangelhaftes Urtheil fällt, wie man etwa über jemanden urteilt, den man nur zufällig getroffen hat, ohne ihn durch längeren Umgang näher kennen gelernt zu haben“. Er räumt allerdings ein, dass „manches im Talmud Enthaltene heute nicht mehr recht angemessen erscheine, was damals gebräuchlich gewesen war“.
Hierzu noch einmal Hirschfeld: „Rasch nimmt der König das Wort auf und tadelt die im Talmud öfter angewandte Erklärungsweise, ‚welche die Vernunft zurückweisen müsste und da der Rabbi ihn auf den bei den Erklärungen der Mischnah und Boreitha aufgewendeten Scharfsinn aufmerksam gemacht hat, steigert er seinen Tadel, indem er in die Worte ausbricht: ‚lch weiß, dass sie in der Dialektik unerreicht sind, aber das ist eben der Beweis, gegen den sich nichts erwidern lässt“.
Diese Stellen bilden gleichsam den Mittelpunkt, um den sämtliche Auseinandersetzungen des Werkes sich ziemlich zwanglos gruppieren. Denn es bespricht nacheinander den gesamten Inhalt des Judentums und was mit demselben in Berührung kommt bis auf Grammatik, Astronomie und Kalenderwesen.
Das erste Buch enthält auf der Grundlage der Untersuchungen über Glaubensmeinungen und religiöse Bekenntnisse überhaupt, wie bereits angedeutet, eine weitere Entwicklung des Grundgedankens, dass der auf der Spekulation beruhende Glaube dem durch Offenbarung empfangenen und durch Überlieferung genährten durchaus weichen müsse“… (p. XXXX ff.)…
Kritik an der jüdischen Apologetik
Wenn wir von jüdischer Apologetik (ἀπολογία, Verteidigung, Rechtfertigung) sprechen, dürfen wir nicht unerwähnt lassen, dass diese durchaus auch auf innerjüdische Kritik stieß. War sie doch stets geneigt eher zu erörtern, was Nichtjuden, zumal Judenhasser, gerade über die Juden debattierten, und weniger das aufgriff, was für Juden am Judentum von Belang war.
So sah es auch Franz Rosenzweig. Für ihn war die Neigung des modernen jüdischen Denkens, eine defensive, „apologetische“ Haltung einzunehmen zwar verständlich, aber dennoch fatal. Paul Mendes-Flohr beschrieb Rosenzweigs Haltung folgendermaßen: „Deutsch-jüdische Intellektuelle, ob liberal oder orthodox eingestellt, versuchten ständig, die verschiedenartigen und oft gehässigen Angriffe der deutschen „Philosophen“ und Gelehrten abzuwehren. Die Antwort der jüdischen Apologeten auf einen spezifischen Angriff sei aber notwendigerweise selektiv und entstellend. Eine nicht-apologetische jüdische Philosophie, wie z. B. im Stern der Erlösung bewege sich innerhalb des Judentums und stelle auf systematische und durchsichtige Weise die Grundsätze und praktischen Spielregeln des Glaubenslebens dar. Eine nicht-apologetische Methode der theologischen Auslegung des Judentums erfordere außerdem, dass sie nicht nur abgeschirmt vom polemischen Umfeld der aktuellen geschichtlichen Situation erarbeitet werden müsse, sondern sogar getrennt vom Leben selbst: Das Judentum müsse nicht in seinem Gegensatz oder Kontrast zum Leben definiert werden, sondern als ein Existenzmodus mit apriorischem Charakter“.
